Wir freuen uns sehr, dass in den letzten 24 Stunden so viele neue Mitglieder den Weg zu uns gefunden haben! Wer noch einer Kollegin oder einem Kollegen Bescheid geben möchte: Wir bieten in den kommenden Wochen vorübergehend ein 30-Tage-Probeabo an – zwei Newsletter pro Woche, voller Zugriff aufs Archiv und Zugang zu unserer Slack-Community. Man kann jederzeit kündigen – es entstehen also in den ersten 30 Tagen keine Kosten. Easy, transparent und fair. Ein Abo kostet übrigens weniger als ein White Mocha Frappuccino pro Monat. Für Redaktionen und Organisationen gibt es zudem Team-Mitgliedschaften. Weitersagen 👍
Was ist
In den vergangenen Wochen haben wir mehrfach ungewöhnliche Gespräche geführt. Menschen, die sich sonst wenig bis gar nicht für KI und Aktien interessieren, wollten wissen, ob sich gerade eine riskante Blase bildet.
Das zeigt: Mittlerweile spricht nicht mehr nur die KI-Blase über eine mögliche KI-Blase. Seit Monaten fragen auch große Medien immer wieder, ob die Billionen-Investitionen in Rechenzentren, Grafikchips und Stromversorgung gerechtfertigt sind.
Um keine falschen Erwartungen zu wecken: Wir können diese Frage nicht beantworten. Niemand kann das mit abschließender Sicherheit. Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
Wir können aber analysieren, was für und was gegen eine Blase spricht und warum die Sorgen zunehmen. Das haben wir bereits im August getan (SMWB). Seitdem wurden ein paar neue Deals geschlossen, und die Summen sind noch ein wenig gigantischer. An den grundlegenden Fakten hat sich aber wenig geändert.
Deshalb wählen wir für heute einen anderen Ansatz. Wir erklären das Thema möglichst voraussetzungsfrei, sodass es auch Menschen verstehen, die sich bislang nicht genauer damit beschäftigt haben. Unsere persönliche anekdotische Evidenz zeigt: Das sind eine ganze Menge.
Wir sind keine Makroökonomen und erst recht keine Finanzberater. Dieses Briefing ist keine Anlageinvestition. Wir verzichten bewusst auf finanzielle Details und nennen nur wenige Zahlen. Viele davon beruhen ohnehin auf Vorhersagen, die mit großer Unsicherheit behaftet sind.
Was „KI“-Investitionen bedeuten
- Seit knapp drei Jahren steht „KI“ in der öffentlichen und medialen Diskussion in erster Linie für generative KI. Damals erschien ChatGPT und löste einen Boom aus, der bis heute anhält.
- GenAI beruht meist auf großen Sprachmodellen (LLMs) oder Diffusionsmodellen, die Bilder und Videos generieren. Das Training und der Betrieb dieser Modelle benötigen viel Rechenleistung.
- Deshalb bauen KI-Konzerne große Rechenzentren, in denen teils Millionen Server mit leistungsfähigen Grafikchips stehen.
- Die GPUs stammen überwiegend von Nvidia, dem wohl größten Profiteur des KI-Wettrüstens. Das Unternehmen baut die schnellsten Chips und liefert die beste Software. Als erster und bislang einziger Konzern wurde Nvidia kürzlich mit mehr als fünf Billionen Dollar bewertet.
- Rechenzentren schlucken viel Energie und benötigen Wasser zur Kühlung (SMWB). Der Stromverbrauch belastet das bestehende Netz. Deshalb muss gleichzeitig mit Rechenzentren auch das Stromnetz ausgebaut werden.
- Daran schließt sich die Frage an: Woher soll die Energie kommen? Erneuerbare Energien reichen oft nicht aus, um den Bedarf zu decken. Rechenzentren benötigen konstante Leistung. Sonne und Wind unterliegen aber Schwankungen, die das Netz nicht komplett abpuffern kann.
- Große Tech-Konzerne haben deshalb Verträge mit Betreibern von Atomkraftwerken geschlossen und sich zur Abnahme großer Mengen Strom verpflichtet, wenn die Kernkraftwerke weiterbetrieben oder reaktiviert werden. Parallel investieren sie in die Forschung für Fusionsenergie.
- Es gibt also drei Engpässe: Rechenleistung, Stromnetz, Energieproduktion.
Warum die Warnungen lauter werden
- Die Investitionen haben Ausmaße angenommen, die man sich schwer vorstellen kann (Washington Post). Bereits jetzt tragen sie mehr zum Wachstum der US-Wirtschaft bei als alle Konsumausgaben (Paul Kedrosky). In den kommenden Jahren sollen mehrere Billionen Dollar in KI-Infrastruktur fließen.
- Bevor die Dotcom-Blase vor 25 Jahren platzte, floss ebenfalls viel Geld in Infrastruktur. Der Ausbau von Glasfaserleitungen legte die Grundlage für den Erfolg von Unternehmen wie Google oder Facebook.
- Bei KI-Infrastruktur gilt das nur teilweise. GPUs müssen nach wenigen Jahren durch leistungsfähigere Technik ersetzt werden. Wer Geld in Rechenzentren steckt, benötigt also kurzfristige Erträge, damit sich die Investitionen lohnen.
- Die Summen sind so gigantisch, dass selbst Google, Meta, Microsoft und Oracle nicht alles selbst finanzieren können (FT). Sie leihen sich von Banken und privaten Geldgebern Dutzende Milliarden Dollar (FAZ).
- Das erzeugt ein systemisches Risiko (Bloomberg). Wenn sich die Rechenzentren nicht rechnen, könnte nicht nur das Silicon Valley wackeln, sondern auch Banken und Fonds.
- Hinzu kommt die strukturelle Schwäche der US-Wirtschaft (Economist). Zwar steigt der S&P 500, der die Aktien der wertvollsten US-Unternehmen bündelt. Das liegt aber fast ausschließlich an den zehn Top-Konzernen, darunter Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Google und Tesla.
- Der restliche „S&P 490“ stagniert seit Jahren. Zuletzt warnten mehrere prominente Ökonomen, die führenden Tech-Konzerne seien mindestens genauso überbewertet wie jene vor 25 Jahren (Fortune).
Was das Risiko erhöht
- Die großen KI-Unternehmen geben nicht nur enorm viel Geld aus. Sie sind auch eng miteinander verwoben. Durch zunehmend komplexe Verträge schieben sie sich die Milliarden gegenseitig zu.
- Bloomberg, FT und die Zeit haben kürzlich versucht, das Chaos zu visualisieren:

- Auch ohne die Details zu verstehen, erkennt man schnell: Ein Großteil dieser Unternehmen ist aufeinander angewiesen (CNBC). Besonders extrem sind die Verstrickungen und Abhängigkeiten bei OpenAI (NYT).
- Selbst die Grafiken zeigen immer nur eine Momentaufnahme. In der Zwischenzeit sind weitere Investitionen und Deals dazugekommen.
- Das erhöht den Hebel in beide Richtungen. Wenn es gut geht, verdienen alle noch mehr Geld. Wenn es schiefgeht, könnte es fürchterlich krachen.
Was niemand weiß
Auf zwei Dinge können sich fast alle einigen:
- Generative KI ist keine Blockchain. Die Technologie hat Substanz. Sie schafft einen Mehrwert für Unternehmen und Nutzerïnnen.
- Ein Teil der Investitionen in generative KI wird sich als Fehler herausstellen. Viele Start-ups werden wahllos mit Geld beworfen. Das ist nicht nachhaltig.
Selbst Sam Altman spricht von einer KI-Blase. Das erscheint bemerkenswert, weil er seit Jahren erzählt, dass KI die Menschheit entweder auslöschen oder retten wird. Erst warnte er vor Science-Fiction-Szenarien, danach predigte er Superintelligenz und Überfluss für alle.
Letztlich spricht er aber nur das Offensichtliche aus. Risikokapital trägt diesen Namen, weil niemand weiß, welches Start-up später ein Geschäftsmodell entwickeln und das Geld wieder einspielen wird.
Die entscheidende Frage lautet also nicht, ob es eine KI-Blase gibt. Das bestreitet kaum jemand. Wirklich relevant sind zwei andere Fragen:
- Wie groß ist die Blase?
- Wird sie mit einem Knall platzen, oder geht ihr langsam die Luft aus?
Die beiden Fragen hängen eng zusammen. Falls sich nur ein paar Start-ups verabschieden, schmerzt das vielleicht Accelerator und Spekulanten. Die Auswirkungen für den gesamten Markt wären überschaubar.
Falls die Blase auch Unternehmen wie OpenAI, Anthropic und Nvidia betrifft, könnte das den gesamten Aktienmarkt und die Weltwirtschaft betreffen. Auch Menschen, die ihr Vermögen in vermeintlich sicheren ETFs angelegt haben, müssten um ihre Altersvorsorge oder zumindest um kurzfristige Rendite bangen (Spiegel).
Was die Geschichte lehrt
Die Vergleiche zur Dotcom-Blase drängen sich auf (Golem, Handelsblatt):
- Eine neue Technologie verheißt Produktivitätsgewinne und begeistert Investoren.
- Kleine Start-ups sammeln Millionen Dollar ein, Unternehmen ohne Geschäftsmodell werden mit Milliarden bewertet.
- Es fließen unfassbare Summen in Infrastruktur, die als Grundlage für die angebliche Revolution gilt.
- Der Hype lässt keinen Raum für Zweifel. Die Angst, etwas zu verpassen, ist größer als die Sorge, dass die Blase platzen könnte.
Damals galten heute vergessene Dotcom-Unternehmen wie Webvan, Etoys und Pets.com als das nächste große Ding. Das Ende ist bekannt: Binnen weniger Monate verpuffte die Euphorie. Hunderte Start-ups gingen pleite, Konzerne wie Amazon und Microsoft verloren den Großteil ihres Börsenwerts.
Doch neben vielen Parallelen gibt es auch Unterschiede:
- Generative KI verändert bereits jetzt Wissenschaft, Wirtschaft und weitere Gesellschaftsbereiche (Air Street Press). Das war bei früheren Blasen anders.
- Im Gegensatz zu vielen Dotcom-Unternehmen sind die meisten KI-Konzerne nicht auf Sand gebaut.
- Amazon, Google, Meta, Microsoft und Nvidia verkaufen Werbung, Cloud-Speicher und Hardware. Das ist ein solides Fundament.
- In Summe setzen sie fast anderthalb Billionen Dollar pro Jahr um und verdienen dabei mehr als 300 Milliarden. Wenn sich jemand eine riskante Wette leisten kann, dann diese Konzerne.
Neue Technologien gehen häufig mit Spekulationsblasen einher (Project Syndicate). Das geschah etwa bei der industriellen Revolution, der Eisenbahn und dem Internet (New Yorker). Die Investoren verloren kurzfristig Geld, schufen aber langfristige Werte (Stratechery). Schienen- und Glasfasernetze überdauerten den Hype und den Crash.
Welche Rolle OpenAI spielt
- OpenAI ist das Brennglas der gesamten KI-Branche. Hier treffen sich Begeisterung und Blasenängste.
- Einerseits überzeugt Altman Investoren, unaufhörlich Geld in das Unternehmen zu stecken.
- Andererseits hat OpenAI dieses Geld auch bitter nötig. Die Umsätze steigen schnell, doch die Verluste steigen noch schneller (Heise).
- Bereits jetzt hat OpenAI Verträge über mehr als eine Billion Dollar abgeschlossen (FT). Um in den kommenden Jahren alle Verpflichtungen zu begleichen, müssen sich die Einnahmen vervielfachen (NYT).
- Während Anthropic den Break-even bereits für 2028 vorhersagt, geht OpenAI davon aus, bis 2030 Geld zu verlieren – insgesamt 14-mal so viel wie Anthropic (WSJ).
- Auch diese Prognose beruht auf Umsätzen in dreistelliger Milliardenhöhe, die heute schwer vorstellbar sind.
- Dafür müsste so ziemlich jede Wette aufgehen, die OpenAI gerade eingeht (SMWB). Das ist nicht ausgeschlossen, aber es gibt gute Gründe, skeptisch zu sein (Will Lockett, Ed Zitron)
Be smart
Bianca Kastl seziert für Netzpolitik die Schattenseiten des KI-Enthusiasmus. Am Ende findet sie ein schönes Bild:
Im Umgang mit Technologie, Digitalisierung und vermeintlicher Innovation brauchen wir dabei nicht hinter den anderen aufgescheuchten Innovationsherdentieren ohne eigenen Plan hinterherzulaufen, sondern vielleicht ein besseres Wappentier: den Esel.
Esel werden oftmals als störrisch und stur wahrgenommen, weil sie nicht sofort auf Anweisungen hören. Dabei sind Esel Tiere mit hoher Intelligenz und hohem Bewusstsein. Auch wenn Esel und Pferde beides Fluchttiere sind, reagieren sie in Gefahrensituationen jeweils anders. Im Moment der Gefahr bleibt der Esel erst mal stehen und analysiert die Situation, er läuft nicht einfach wild weg oder hinterher.
Ein einfacher Esel hat damit mehr Bewusstsein als jede noch so komplexe und teure KI, die in der heutigen Form ohnehin nie Bewusstsein erreichen wird. Ein einfacher Esel hat damit mehr Bewusstsein als die geradezu schreckhaft reagierende Geschäfts- und Aktienhandelswelt, die wild der Gefahr von verpassten zweifelhaften Chancen hinterherläuft. Zu gegebener Zeit ist es besser, eher wie ein Esel zu sein und dementsprechend zu handeln.
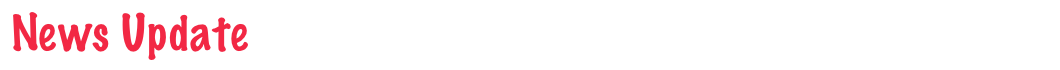
Politics & Power
- Europäische Kommission plant offenbar DSGVO-Reform: Die EU-Datenschutzverordnung sorgt seit 2018 dafür, dass persönliche Daten fair und transparent behandelt werden müssen. Am 19.11. sollen nun Pläne zur Reform vorgestellt werden, die Max Schrems (noyb.eu) zufolge „40 Jahre europäische Grundrechtsdoktrin über den Haufen“ werfen könnten (Netzpolitik). Ob es so arg kommt, muss sich noch zeigen. Es klingt jedenfalls stark danach, dass die EU für höhere Wettbewerbsfähigkeit im Bereich künstliche Intelligenz geringeren Datenschutz in Kauf nehmen möchte. (Heise)
Attention Economy
- Meta begräbt Like- und Comment-Plug-ins: Am 10.2.2026 endet eine Ära: Meta schaltet dann die beiden wichtigsten Plug-ins der frühen Social-Media-Jahre ab: den Facebook Like Button und den Facebook Comment Button. Wie groß waren die Bemühungen in den Redaktionen, diese Features möglichst rasch zu implementieren. Wie viel größer jedoch war der Aha-Moment, als man anfing zu verstehen, wie viele Daten Facebook absaugt und wie viele Nutzerïnnen das Unternehmen an sich bindet. Nun ist laut Meta die Online-Welt eine andere, die Buttons nicht weiter von Belang (Meta). Recht haben sie. Und wir haben beim Social Media Watchblog weite Teile davon dokumentiert.
- CNN hat jetzt einen Shorts-Feed auf der Homepage und bietet ebenfalls einen zentralen Ort für alle Hochkant-Videos zum Durchswipen (The Verge). Schon erstaunlich, wie lange es dauert, bis Mediengiganten wie CNN und Co neue „Kulturtechniken” integrieren. Der Hype um TikTok begann vor sechseinhalb Jahren. 👀
- TikTok will vom Podcast-Boom profitieren: In der ARD-Mediathek gibt es diesen einen Sketch: Darin erwacht ein Mann aus dem Koma und staunt nicht schlecht: Er ist tatsächlich der letzte Mensch ohne Podcast. Was Jakob Leube, Freddy Radeke und Lea Finn in ihrem Film so herrlich auf den Punkt bringen, ist auch TikTok nicht entgangen. Die ByteDance-Tochter launcht daher gemeinsam mit iHeartMedia ein neues Podcast-Netzwerk, das zunächst 25 Creator-Shows umfasst. Ein bisschen late to the party. Aber nicht ganz so late wie CNN mit dem Feed. (TikTok)
- Amazon Music testet „Fan Groups”: Sind hier Kanadier unter unseren Leserïnnen? Unseren Statsistiken nach ist das nicht der Fall. So oder so ist es spannend, was Amazon im zweitgrößten Staat der Welt treibt: Nutzerïnnen von Amazon Music können dort testweise sogenannten „Fan-Gruppen“ beitreten, um sich mit anderen Fans über ihre Lieblingskünstler auszutauschen (Amazon). Spannend, wie Musik verbindet. TikTok hat als Social-Media- und Entertainment-Plattform ein eigenes Geschäftsmodell rund um Musik etabliert. Streaming-Plattformen integrieren zunehmend „Social“-Elemente. ♻️
- So viel Zeit verbringen Teenager vor dem Bildschirm: Die ZEIT hat aktuelle Daten des Statistischen Bundesamts ausgewertet, um Einblicke in das Medienverhalten von Kindern und Jugendlichen zu erhalten. Zehn- bis 18-Jährige verbringen demnach mehr als 200 Minuten täglich vor Bildschirmen. Nur um 18:00 Uhr gönnen sie sich eine kurze Pause – zum Abendessen. (ZEIT / €)



