Was ist
In den USA steht die Wikimedia Foundation unter Druck. Rechte und Rechtsradikale bedrohen die Organisation, die hinter der Wikipedia steht, allen voran Elon Musk und ein dubioser Staatsanwalt.
Die Attacken verlaufen auf mehreren Ebenen: politisch, wirtschaftlich und juristisch. Es geht um die Glaubwürdigkeit der Wikipedia und die Gemeinnützigkeit der Wikimedia Foundation – zwei wichtige Säulen für die Enzyklopädie.
Warum das wichtig ist
Wir halten die Kampagne gegen die Wikipedia aus zwei Gründen für berichtenswert:
- Die Wikipedia ist nicht nur eine der am häufigsten besuchten Webseiten, sondern eine der besten Errungenschaften des World Wide Web. Sie gilt vielen als vertrauenswürdig und vereint bis heute viele der Hoffnungen, die Menschen in den 90er-Jahren ins Internet gesetzt haben. Millionen Menschen sammeln und bewahren das Wissen der Welt, Milliarden profitieren davon. Die Wikipedia ist offen und unkommerziell, transparent und regelbasiert, faktenorientiert und überparteilich – also das Gegenteil der meisten großen Plattformen.
- Hinter den Angriffen auf die Wikipedia steckt eine nur allzu bekannte Strategie. Das Trump-Lager attackiert alle Institutionen, die sich Steve Bannons "Flood the zone with shit" entgegenstellen, indem sie selbst seriöse Informationen verbreiten und hervorbringen: Wissenschaft, Universitäten, unabhängige Medien und jetzt die Wikipedia. Letztlich ist die aktuelle Kampagne ein Angriff auf die Demokratie in den USA.
Wie die Attacken ablaufen
Der Großteil der Einschüchterungsversuche und Pöbeleien ist eindeutig politisch motiviert. Die meisten Vorwürfe sind so absurd, dass sie keine inhaltliche Auseinandersetzung verdienen. Also nur ein knapper Überblick:
- Die Trump-Regierung wirft der Wikimedia Foundation vor, die Verbreitung von Propaganda zu ermöglichen, Geschichte umzuschreiben und damit die Sicherheit und Interessen der USA zu gefährden. Deshalb droht der Staatsanwalt Ed Martin, der Wikimedia die Gemeinnützigkeit zu entziehen (Washington Post). Besonders stört er sich an der Pseudonymität der Wikipedianerïnnen, die angeblich Transparenz verhindere und Manipulation ermögliche.
- Es ist einer von mehreren Drohbriefen, die Martin in den vergangenen Tagen verschickt, unter anderem attackiert er auch Wissenschaftsverlage. Apropos Propaganda-Vorwürfe: Der Staatsanwalt selbst kennt sich damit ganz gut aus. Er trat rund 150 Mal im russischen Staatsfernsehen auf, machte Stimmung gegen die Ukraine (The Atlantic) und fiel immer wieder mit Nähe zu Rassisten und Rechtsextremen auf (ProPublica, CNN)
- Rechte Kulturkämpfer rund um Musk und Accounts wie Libs of TikTok unterstellen der Wikipedia seit Herbst 2024 immer wieder, sie sei "woke" und linksliberal dominiert. Musk ruft öffentlich dazu auf, nicht mehr für die Wikipedia zu spenden – unter anderem, weil die Wikipedia-Community seinen Hitlergruß als solchen benannte und die Debatte dokumentierte (Wikipedia).
- In den vergangenen Monaten warfen zwei rechtskonservative Thinktanks, das Manhattan Institute und das Media Research Center, der Wikipedia ebenfalls Voreingenommenheit vor. Zudem will die ultrarechte Heritage Foundation die Identität von pseudonymen Wikipedianerïnnen enthüllen, die Pläne wurden im Januar bekannt (Forward).
- Solche konzertierten Angriffe auf die Wikipedia gab es früher eher in autoritären Regimen wie China, Russland oder der Türkei. Mittlerweile muss man die USA in dieser Reihe nennen.
Wie die Wikimedia reagiert
Normalerweise hält sich die Wikimedia Foundation im Hintergrund. Nach den Einschüchterungsversuchen des Staatsanwalts Martin äußerte sie sich aber öffentlich.
Man nahm zwar nicht direkt Bezug auf den Drohbrief, ein Sprecher teilte aber mit, die Wikipedia sei "einer der letzten digitalen Orte, die das Versprechen des Internets widerspiegelten". Die Enzyklopädie habe sich Regeln gegeben, die sicherstellten, dass Informationen so akkurat, fair und neutral wie möglich wiedergegeben würden.
Wir haben auch bei Wikimedia Deutschland nachgefragt, wie die Attacken in den USA hierzulande wahrgenommen und beurteilt werden. Zu vielen Details konnte oder wollte sich Vorständin Franziska Heine nicht äußern. Einige Antworten möchten wir hier aber (teils gekürzt) zitieren:
- Zur Debatte um Pseudonymität: "In der Wikipedia-Community gilt aber ganz klar: Jede und jeder entscheidet selbst, ob er oder sie die Identität preisgibt. Outing ist verboten. (…) Damit Menschen sich frei von Angst äußern und auch Wissen teilen können, braucht es Anonymität. Denn es gibt unterschiedliche Themen, die kommunikative Tabus darstellen, die extrem kontrovers sind oder in einigen Ländern gar nicht offen angesprochen werden dürfen. Das betrifft etwa Themen wie Klimawandel, Religion, kritische Informationen zu politischen Führungspersonen, Informationen zu LGBTQ+ Themen oder historische Ereignisse und deren Bewertung. Wenn Wikipedianer*innen Wissen nicht mehr anonym teilen können und Repressionen fürchten müssen, dann kann das Zugang zu freiem Wissen beschränken."
- Zur Frage, ob Musks Boykott-Aufrufe Wirkung zeigen: "Nein. Wikimedia Deutschland hat das Spendenziel für 2024 erreicht. Zahlreiche Nachrichten in unserem Spendenticker haben Ende des Jahres 2024 gezeigt, dass Menschen uns gespendet haben, weil sie sich gerade jetzt der Bedeutung von Freiem Wissen im Sinne der Wikimedia-Projekte bewusst werden. Und die Spendenzahlen der Wikimedia Foundation zeigen einen Anstieg."
- Zum Vorwurf der linksliberalen Voreingenommenheit: "Diese Beobachtung können wir nicht teilen. Zum einen gibt es die eingangs genannten Regeln und da besonders die Anforderung, das Wissen in der Wikipedia so neutral und ausgewogen wie möglich dargestellt sein muss. Und diese Regeln sind schließlich keine bloßen Empfehlungen. Darüber, dass sie eingehalten werden, wachen – alleine in der deutschsprachigen Community – über 6.000 Freiwillige. Zum anderen legen aus unserer Sicht Ereignisse wie die Manipulationsversuche von rechten sogenannten Sockenpuppen in der deutschsprachigen Wikipedia (ARD Mediathek) oder die Angriffe auf die Neutralität der Wikipedia im autokratischen Russland oder die mittlerweile aufgehobene Sperrung der Wikipedia in der Türkei nahe, dass freies Wissen vor allem aus diesen Richtungen Manipulationsversuchen ausgesetzt ist."
- Zur Situation in Deutschland: "Wir finden es grundsätzlich problematisch, wenn Menschen Misstrauen in die Wikipedia schüren. Egal, ob das absichtlich oder einfach aus Unwissen darüber passiert, wie die Wikipedia funktioniert und warum sie eine verlässliche Quelle ist. (…) Wir leiten aus den seit vielen Jahren gleichbleibend hohen Nutzendenzahlen der deutschsprachigen Wikipedia (durchschnittlich 26 Millionen täglich) ab, dass das Vertrauen in Wikipedia ungebrochen ist."
Was die Angriffe für die Wikipedia bedeuten
Ein möglicher Verlust der Gemeinnützigkeit wäre für die Wikimedia Foundation existenzbedrohend. Die Organisation würde dann wie ein gewöhnliches Unternehmen besteuert und müsste mit signifikant weniger Spenden- und Fördermittel rechnen, da diese nicht mehr steuerlich absetzbar wären. Mehr als 90 Prozent des Jahresbudgets stammen aus Spenden, ein Rückgang wäre äußerst bedrohlich.
Bislang ist dieses Szenario eher unwahrscheinlich. Die Wikimedia soll bis Mitte Mai auf den Fragenkatalog des Staatsanwalts Martin antworten, dann erwägt er weitere Schritte. Wir halten den Brief eher für einen Einschüchterungsversuch als für eine substanzielle Drohung. Allerdings zeigt das Beispiel der Universität Harvard, der die Regierung Fördermittel in Milliardenhöhe entzogen hat, dass Trump nicht davor zurückschreckt, sich mit etablierten und weltweit geschätzten Institutionen anzulegen.
Die Wikipedia ist auf solche Angriffe leider ebenso wenig vorbereitet wie Universitäten und Verlage. Nicolas Killian, Meike Laaff und Lisa Hegemann beschreiben das Problem so (Zeit):
Diese Regeln funktionieren bei Unterwanderungsversuchen durch die Hintertür. Die Einhaltung dieser Grundsätze, die akribische Kleinarbeit zahlloser Autorinnen und Admins ist die Stärke, der Schutz der Wikipedia: Hier wird sich an Fakten abgearbeitet. Dieser Teil des Immunsystems der Wikipedia ist gut ausgebildet, trainiert seit den Anfangstagen. Aber diese Regeln bleiben wirkungslos, wenn jemand die Eingangstür eintritt. So wie nun Musk oder Martin: Sie greifen frontal die Glaubwürdigkeit der gesamten Wikipedia an, ohne groß Belege oder Fakten anzuführen.
(…)
Und so ist das, was mit der Wikipedia geschieht, exemplarisch für viele Diskurse, die Rechte der Öffentlichkeit aufzwingen, für ihr Playbook: Auf der einen Seite stehen Menschen, die sich ernsthaft mit einem Problem beschäftigen. Die Forschungsarbeiten zusammenstellen, nach Lösungen suchen. Auf der anderen Seite steht ein Mann, der nur publikumswirksame Fundamentalkritik von sich gibt, die einen Funken Wahrheit enthält und zur Größe eines Buschfeuers aufbläst. Solche Pauschalangriffe lassen sich nicht mit Detailarbeit entkräften. Auf diese Weise wird nur kaputt geredet, aber nichts verbessert.
Der Text enthält auch Szenen von der Konferenz WikiCredCon, bei der sich im Februar Wikipedianerïnnen in San Francisco trafen. Die Schilderungen machen deutlich, welchen Anfeindungen die Freiwilligen ausgesetzt sind und wie bedroht sie sich fühlen.
Mehrfach mussten Treffen wegen Drohungen abgesagt werden, einzelne Wikipedianer werden wöchentlich beleidigt und beschimpft. So wird aus einem ehrenamtlichen Hobby mit Mehrwert für die Allgemeinheit ein Sicherheitsrisiko für sich selbst und das eigene Umfeld.
Die systematischen Repressalien und Festnahmen, mit denen US-Regierung und Sicherheitsbehörden gegen Andersdenkende vorgehen, beunruhigen auch die Wikipedia-Community:
Als ein Vertreter der weltweiten Wikimedia-Stiftung zur Gruppe stößt, konfrontieren ihn die Teilnehmer mit einer drängenden Frage: Welche Daten speichert die Organisation über sie und andere Wikipedia-Autoren? Die Angst ist groß, dass US-Behörden oder US-Gerichte die Non-Profit-Organisation zwingen könnten, persönliche Informationen herauszugeben – und damit die Identität der Autoren preiszugeben. Das Vertrauen in den Rechtsstaat ist zumindest in dieser Runde kaum vorhanden. Auch auf die Wikimedia Foundation scheint sie sich nicht verlassen zu wollen. "Wir sind nicht vorbereitet", sagt eine der Frauen energisch. "Wir haben verdammte Angst."
Be smart
Die Wikipedia ist nicht perfekt. Trotz jahrelanger Bemühungen der Wikimedia beteiligen sich zu wenige Frauen, viele schreckt der Umgangston ab. Die Community ist männlich, weiß, akademisch und kein repräsentatives Abbild der Bevölkerung (Wikimedia Meta). Die Zahlen schwanken je nach Land, weisen aber meist ähnliche Tendenzen auf.
An dieser Stelle kommt aber wieder eine der großen Stärken der Wikipedia ins Spiel. Natürlich gibt es zu diesem Thema einen ausführlichen, faktenbasierten Wikipedia-Eintrag, der das Problem und seine Folgen klar benennt.
Auch der Vorwurf der politisch-ideologischen Voreingenommenheit lässt sich am besten in der Wikipedia selbst überprüfen – samt ausführlichem Bearbeitungsverlauf, der alle Änderungen und Diskussionen sichtbar macht. Musk, der seit Jahren "maximale Transparenz" auf X verspricht, müsste der größte Fan der Wikipedia sein.
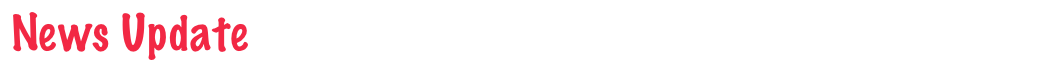
Politics
- Strafe für TikTok: Wegen der unerlaubten Übermittlung europäischer Nutzerdaten nach China wurde TikTok von EU-Datenschützern zu einer Strafe in Höhe von 530 Millionen Euro verurteilt. TikTok muss die App zudem innerhalb von sechs Monaten an EU-Vorgaben anpassen. (Data Protection Commission)
- Aufschub für TikTok: US-Präsident Trump will TikTok erneut Aufschub gewähren, sollte kein Deal in den kommenden Wochen zustande kommen. Na klar. (Axios)
- Terrorgram: Telegram dient zunehmend als Plattform für rechtsextreme Netzwerke. Experten konnten mehr als 650 Deutsche in sogenannten "Terrorgram"-Gruppen finden. (Tagesschau)
- Hackerangriff. Ein Angriff auf den Signal-Klon TeleMessage hat Daten der US-Regierung offengelegt. (404 Media)
- Lockerungen: Ein US-Richter hat Apple zur Lockerung der App-Store-Regeln aufgefordert. Drittanbieter könnten dadurch deutlich mehr Geld im App-Store verdienen. (CNN)
- Airtime: Trumps Team war in den ersten 100 Tagen der zweiten Amtszeit bereits über 500 Mal bei Fox News zu Gast. Nur falls sich irgendjemand fragt, ob Fox News diesmal anders mit Trump umgeht. Nope. (Media Matters)
Next (KI, VR, AR, Metaverse)
- Meta bringt eigenständige KI-App an den Start, um besser mit OpenAI und Co mithalten zu können (Meta). Die App zeigt u.a. in einem eigenen Feed, was Freunde mittels KI so alles anstellen (The Verge) — ziemlich creepy irgendwie (Washington Post).
- Google führt erstmals den „AI Mode“ für die Suche ein: Ausgewählte US-Nutzerïnnen erhalten in den kommenden Wochen Zugriff auf den KI-gestützten Such-Chatbot außerhalb der Testumgebung. (The Verge)
- Google hat zudem seine Musik-KI-Sandbox überarbeitet – alles zwar eher noch Demo als echter Ersatz für Cubase und Co. Aber es zeigt sich auch hier der Pfad, der eingeschlagen wird: Kreative Routinearbeit dürfte demnächst komplett automatisiert werden. (Deepmind)
- Sam Altmans umstrittenes Krypto-Projekt Worldcoin, das mit Augenscans arbeitet, ist jetzt auch in den USA verfügbar – weltweit haben sich bereits über elf Millionen Menschen per „Orb“ verifizieren lassen. (Wall Street Journal)
- Meta sieht sich mit einer Klage konfrontiert, in der geprüft werden soll, ob KI-Unternehmen urheberrechtlich geschütztes Material für das Training ihrer Sprachmodelle nutzen dürfen. (Financial Times)
- Pinterest führt neue Tools ein, die KI-bearbeitete Bilder automatisch markieren und es Nutzerïnnen ermöglichen, entsprechende Inhalte gezielt auszublenden. (The Verge)
- Vibe Coding : Was im Silicon Valley bejubelt wird, muss bekanntlich nicht zwangsläufig auch echten Fortschritt bedeuten. Das Thema Vibe Coding erregt gerade vielerorts die Gemüter — zu Recht. Schließlich stellt sich die Frage, wie viele Arbeitsplätze es kostet, wenn künftig einfach nur „nach Gefühl“ programmiert werden kann. (Zeit)
Future of Media
- Das habe ich bei TikTok gesehen! TikTok entwickelt sich laut aktuellen Zahlen von NewsWhip zu einem immer bedeutenderen Player, wenn es um Informationsvermittlung geht. Überhaupt seien Kurzvideos für viele das Mittel der Wahl, um sich über aktuelle Entwicklungen zu informieren. Publisher, die weiter auf das Medium verzichten, sollten dringend ihre Berater wechseln.
TikTok’s ever-growing influence as a primary platform for news consumption is becoming more clear, especially among younger audiences. More so, short-form video (Reels, TikToks, Shorts) isn’t just growing; it’s often the dominant format for engagement across many social platforms beyond TikTok.
- Video-Podcasts werden zu TV-Shows: Stars wie Ezra Klein haben das früh verstanden. Andere noch nicht wirklich. (Vanity Fair)
- Creator-Economy nimmt weiter an Fahrt auf: Ein neuer Bericht zeigt: Die Zahl der hauptberuflichen Creator ist in den USA von 200.000 im Jahr 2020 auf 1,5 Millionen im Jahr 2024 gestiegen (Axios). Es schaffen aber längst nicht alle, ihre Passion wirklich nachhaltig zum Beruf zu machen (Digiday).
- LinkedIn buhlt um (Video-) Creator: Künftig will das Unternehmen Werbeeinnahmen mit Kreativen teilen. Auch sollen Werbetreibende Posts sponsern können. Zudem meldet LinkedIn, dass Videos immer beliebter werden: Nutzerïnnen schauten 36 Prozent mehr Videos als noch vor einem Jahr. Klingt nach einem satten Anstieg. Aber es ist natürlich auch immer die Frage, wie viel mehr Videos eine Plattform ihren Userïnnen ausspielt. Aber egal. Die Richtung, die hier von LinkedIn eingeschlagen wurde, wird ja deutlich. (Bloomberg)
Internet Culture
- Wie süchtig machen eigentlich KI-Chatbots? Heute ist so eine Ausgabe, da hätten wir locker drei, vier Analysen schreiben können. Unter anderem zu Mark Zuckerbergs KI-Visionen für Meta. Super spannend, was dort kommen soll und wie Zuckerberg die Rolle seiner Plattformen sieht. Da steckt so viel drin, wie sich das Internet in den kommenden Monaten und Jahren entwickeln könnte. Crazy. Wir holen das die Tage nach und verweisen heute erstmal nur auf das bemerkenswerte Interview drüben bei Ben Thompson (Stratechery). Dort sagt Metas Chef:
I personally have the belief that everyone should probably have a therapist, it’s like someone they can just talk to throughout the day, or not necessarily throughout the day, but about whatever issues they’re worried about and for people who don’t have a person who’s a therapist, I think everyone will have an AI. And all right, that’s not going to replace the friends you have, but it will probably be additive in some way for a lot of people’s lives.
- Gehirnfäule: "Brainrot" beschreibt laut ChatGPT den Zustand, „wenn man sich so stark und dauerhaft mit einem bestimmten Inhalt oder Medium beschäftigt, dass es das Denken oder Verhalten auf eine obsessive, manchmal „verblödende“ Weise beeinflusst“. Drüben bei Pitchfork wird eindrücklich beschrieben, welchen Einfluss TikTok dabei spielt, rechte Ideologien in den Köpfen junger Menschen zu zementieren.
- Whatnot kennst du vermutlich auch noch nicht. Oder doch? Wir kannten die Plattform bis vor ein paar Wochen jedenfalls noch nicht. Dabei ist die Livestream-Shopping-App in den USA äußerst populär. Rund drei Milliarden Dollar Umsatz hat Whatnot laut The Information im vergangenen Jahr bereits erzielt. Nutzerïnnen verbringen durchschnittlich gut 80 Minuten am Tag in der App und kaufen mehr als 12 Dinge pro Woche.
- TikTok hat letztlich doch nur einen Feed: TikTok bietet bekanntlich zwei Feeds: „Für dich“ (also die For-You-Page) und „Folge ich“. Was schätzt du, wie viel Zeit verbringen Nutzerïnnen jeweils in dem einen, bzw. anderen Feed? Na? Eine Idee? Nun, die Antwort könnte dich verunsichern: Nur gut ein Prozent der Zeit, die Userïnnen in der App verbringen, entfällt laut TikTok auf den Friends-Feed. Ein Prozent! Dass TikTok in erster Linie eine Entertainment-Plattform ist, wussten wir. Wie wenig social die App aber ist, überrascht uns dann doch. (The Information)
- Snap verliert Userïnnen in Nordamerika: Das ist in der Regel kein allzu gutes Zeichen. (The Verge)
- Kriterien für ein Unfollow: Drüben bei mkln haben wir diese sehr gute Liste mit neun Gründen gefunden, wann man einem Account entfolgen sollte.
- Frank Westphal möchte eine Blogsuchmaschine bauen und sucht dafür via Steady Supporter. Wir unterstützen das. Mehr Blogs, weniger walled gardens! (Rivva)
- Der Kompass von Bluesky-Chefin Jay Graber zeigt sich gut eingestellt (Time):
“We don't want to create a world where I'm a new emperor who rules more kindly. We want a world where there's no need for emperors at all.”
Features bei den Plattformen
YouTube
- YouTube TV hat jetzt ein Podcast-Tab. Zudem werden Shorts von längeren Videos besser separiert.
- Reddits KI-Such-Tool wird noch etwas prominenter eingebunden. (Engadget)
Salut! Wenn du uns heute zum ersten Mal liest oder künftig gern alle Ausgaben in voller Länge lesen möchtest, kannst du hier Mitglied werden: socialmediawatchblog.de/mitgliedschaft 📧 ☀️ ☕




